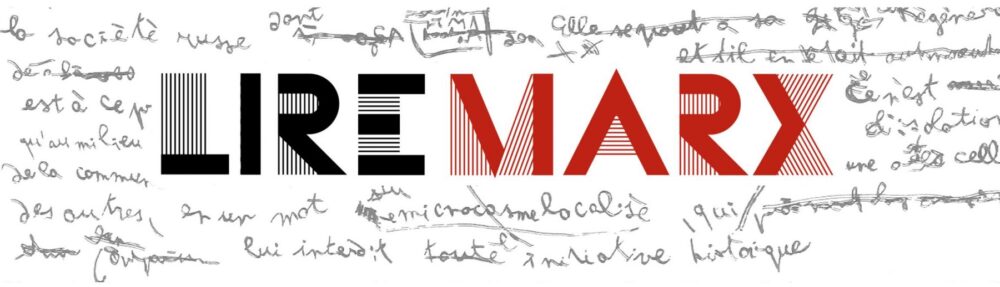Geld und Kredit in der Kritik der politischen Ökonomie, Michael Heinrich
Geld und Kredit in der Kritik der politischen Ökonomie, Michael Heinrich
in: Das Argument 251, 2003, S.397-409
Article sur le site de Michael Heinrich
Vor dem Hintergrund internationalisierter Finanzmärkte, häufiger werdenden Währungskrisen und Crashs an den Aktienmärkten besitzt die Diskussion über Geld und Kredit eine unmittelbar politische Aktualität. Der neoliberale Ruf nach Deregulierung der Märkte ist zwar keineswegs verstummt, doch wird bereits über eine Re-Regulierung diskutiert. Großen Teilen der globalisierungskritischen Bewegungen erscheint die Bändigung der Finanzmärkte als der entscheidende Hebel für die Zähmung des „entfesselten Kapitalismus“. Geld- und kredittheoretische Fragen betreffen also nicht bloß Fachökonomisches, verhandelt werden vielmehr die spezifischen Vergesellschaftungsweisen im gegenwärtigen Kapitalismus.
In den herrschenden ökonomischen Theorien ist davon nicht viel zu spüren. Nicht die soziale Form Geld, sondern die Funktionen des Geldes interessieren dort. Klassik und Neoklassik sehen im Geld vor allem ein Tauschmittel, letztlich ein bloß technisches Hilfsmittel, das für die Theoriebildung im Grunde uninteressant ist. Der Keynesianismus nimmt Geld als Wertaufbewahrungs- und Kreditmittel zwar durchaus ernst, die Art und Weise der über Geld und Tausch vermittelten Vergesellschaftung wird hier aber genauso wenig zum Problem wie bei der Neoklassik, sie wird einfach unterstellt. Dagegen zielt Marx’ Kritik der politischen Ökonomie auf die Dechiffrierung jenes Typus ökonomischer Gegenständlichkeit, der in den herrschenden Theorien immer schon vorausgesetzt wird. Die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht eine weitere ökonomische oder soziologische Theorie neben anderen, sondern in einem emphatischen Sinne „Kritik“: Kritik nicht nur an einzelnen Theorien, sondern an dem diese Theorien konstituierenden Gegenstandsverständnis.
In den Rezeptionslinien, die seit dem späten 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung vorherrschten, wurde dieses „kritische“ Unternehmen aber in eine eklektische Weltanschauung namens „Marxismus“ (später „Marxismus-Leninismus“) umgemünzt. Ein Prozess, dem einerseits durch den fragmentarischen Charakter der Kritik der politischen Ökonomie und die popularisierenden Schriften von Engels (vor allem den Anti-Dühring) Vorschub geleistet wurde, der andererseits aber auch nicht möglich gewesen wäre, wenn Arbeiterbewegung und Arbeiterparteien, die sich in Gestalt einer „negativen Integration“ (Groh 1973) in der bürgerlichen Gesellschaft konsolidierten, nicht selbst ein Bedürfnis nach Weltanschauung entwickelt hätten.
Der weltanschauliche Dogmatismus eines „dialektischen“ und „historischen“ Materialismus wurde zwar schon seit den 20er Jahren kritisiert. Die Reduktion der Kritik der politischen Ökonomie auf eine „marxistische politische Ökonomie“, wie sie nicht nur für realsozialistische Lehrbücher, sondern auch für im Westen weit verbreitete Darstellungen wie die von Sweezy (1942), Meek (1956) oder Mandel (1962) typisch war, wurde erst ab den späten 60er Jahren zum Thema. Erst jetzt wurden auch schon früher abweichende Stimmen, wie die von Rubin (1924) überhaupt bekannt. Im Mainstream des traditionellen Marxismus wurde die Marxsche Werttheorie auf eine Arbeitsmengentheorie (Arbeitsmenge bestimmt die Austauschverhältnisse) und eine Theorie der Ausbeutung reduziert – was Linksricardianer bereits in den 1830er Jahren vertreten hatten. Wo Marx über deren Positionen hinausging, wurden seine Argumente meistens entweder ignoriert oder banalisiert. Man diskutierte das Konzept der abstrakten Arbeit entweder überhaupt nicht weiter oder verwandelte es in eine überhistorische Abstraktion; die Wertformanalyse galt als kurzgefasste Darstellung der historischen Herausbildung des Geldes. Was Marx schon an Ricardos Werttheorie kritisierte, die Unfähigkeit, den monetären Charakter des Werts auch nur in den Blick zu bekommen (z.B. MEW 26.2, 161), traf auch für den traditionsmarxistischen Mainstream zu. Geld und Kredit galten ihm als „bloße Zirkulationsphänomene“, die eigentlich wichtige Sphäre war allein die Produktion. Als Begründung einer marxistischen Krisentheorie wurde daher mit Zähnen und Klauen das „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“ verteidigt; jenseits davon konnte man sich keine Krisentheorie mehr vorstellen.
Die Wertformanalyse: „Logisches“ oder „Historisches“?
Schon lange vor der Abfassung des Kapital machte Marx in seiner Auseinandersetzung mit Proudhon deutlich, dass die ökonomischen Kategorien einen historischen Charakter haben: sie sind nur gültig für eine bestimmte historische Produktionsweise (MEW 4, 130; MEW 27, 457). Wer von einem ahistorischen Charakter der ökonomischen Kategorien ausgeht, und den Faustkeil eines Neandertalers für Kapital hält, verwechselt ökonomische Formbestimmung mit sachlichem Inhalt. Zwar werden in allen Produktionsweisen Produktionsmittel benötigt, aber nur in der kapitalistischen Produktionsweise nehmen sie die Form von Kapital, von sich verwertendem Wert an. Insofern sind Kapital (sowie Geld, Wert etc.) historische Kategorien.
Von einem historischen Charakter der Kategorien wird allerdings noch in einem anderen Sinn gesprochen. Marx betont, dass er die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie in ihrem Zusammenhang „entwickeln“ will, in der Wertformanalyse geht es ihm darum, die „Genesis dieser Geldform nachzuweisen“ (MEW 23, 62). Dass es sich bei dieser Genesis nicht um eine detaillierte historische Nacherzählung der Geldentstehung handelt, ist offensichtlich. Aber welchen Charakter hat diese „Genesis“ dann? Maßgeblich beeinflusst wurden die späteren Debatten von Engels. In seiner Rezension von Zur Kritik der politischen Ökonomie schrieb er, dass die Kritik der Ökonomie „historisch oder logisch“ angelegt werden könnte (MEW 13, 474). Marx habe zwar die „logische Behandlungsweise“ gewählt (d.h. eine begrifflich-kategoriale Darstellung), doch sei diese „in der Tat nichts anderes als die historische, nur entkleidet der historischen Form und der störenden Zufälligkeiten“, ein „Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch konsequenter Form, des historischen Verlaufs“ (MEW 13, 475).[1]
Die Auffassung, die „logische Behandlungsweise“ sei nur ein abstraktes Spiegelbild der historischen Entwicklung, dominierte im traditionellen Marxismus. Ausführlich wurde sie u. a. in einem Aufsatz von Klaus Holzkamp dargelegt, der 1974 in Argument 84 erschien. Wesentliche Elemente dieser Auffassung finden sich auch bei Wolfgang Fritz Haug, etwa in dem HKWM-Stichwort „Genesis“ oder in dem in diesem Heft abgedruckten Entwurf für das Stichwort „Historisches/Logisches“. Im erstgenannten Stichwort wird die Wertformanalyse als „Paradigma genetischer Rekonstruktion“ bezeichnet. Was „Genesis“ aber bedeuten soll, wird gleich zu Anfang des Stichworts in enger sachlicher Anlehnung an Engels definitorisch, ohne weitere Diskussion festgelegt: Genesis „unterscheidet sich vom Historischen dadurch, dass darunter ein bestimmter Entstehungszusammenhang ‚in Reinkultur’, unter Ausblendung von Überlagerungen verstanden werden kann“ (Haug 2001, 261).[2] Damit ist bereits durch eine scheinbar harmlose Begriffsdefinition ein Deutungsraster vorgegeben, noch bevor die Auseinandersetzung mit dem Marxschen Text überhaupt beginnt. Dementsprechend verläuft die Skizzierung der Wertformanalyse lediglich über die Passagen, in denen Marx nach erfolgter Analyse (jedoch nicht als deren Begründung) anmerkt, dass die einzelnen Formen historisch irgendwann existierten. Durch diese Auswahl wird unterstellt das Wesentliche der Wertformanalyse sei die abstrakte Darstellung eines historischen Prozesses „über dessen konkret-historisches Auftreten damit allerdings noch nichts gesagt ist, außer dass er irgendwann in dieser Sequenz erfolgt sein muss“ (ebd., 266).
Würde es bei der Wertformanalyse tatsächlich nur darum gehen, auf einer allgemeinen Ebene deutlich zu machen, dass die historische Ausbreitung von Tauschverhältnissen schließlich ein allgemeines Äquivalent hervorbringen muss, dann würde sich die Wertformanalyse auf eine Banalität reduzieren; eine Banalität, die von Ökonomen weder im 19. noch im 20.Jahrhundert bestritten wurde. Der Marxsche Anspruch „zu leisten, was von der bürgerlichen Ökonomie nicht einmal versucht ward, nämlich die Genesis dieser Geldform nachzuweisen“ (MEW 23, 62, Hervorhebung M. H.) wäre dann maßlos überzogen. Mit dieser Banalität hätte die Wertformanalyse auch nicht das leisten können, was sich Marx von ihr versprach, einerseits den Nachweis für die Unhaltbarkeit der Proudhonschen Sozialismusvorstellung zu erbringen, die auf eine Beibehaltung der Warenproduktion bei Abschaffung des Geldes hinauslief, und andererseits eine Fundamentalkritik am theoretischen Umgang der klassischen politischen Ökonomie mit Geld zu liefern. Dass Geld sich historisch herausgebildet hat, und dass diese Herausbildung nicht zufällig vonstatten ging, sondern in gewissem Sinne „notwendig“ war, um den Tausch zu erleichtern, ist noch lange keine Widerlegung von Proudhons These, dass heute, unter den Bedingungen voll entwickelter Tauschverhältnisse durch günstige institutionelle Vorkehrungen vielleicht doch wieder auf Geld verzichtet werden könnte. Und erst recht nicht ist das auch von Haug als Triebkraft der Wertformentwicklung verstandene „Unpraktische, Disfunktionale“, das zur Aufhebung einer Form führen soll (Haug 2001, 266), ein Argument gegen die klassisch-neoklassische Elimination des Geldes aus der Theorie. Dort wird ja keineswegs bestritten, dass Geld praktisch und funktional ist, es wird vielmehr behauptet, dass die wesentlichen ökonomischen Beziehungen auch ohne Geld modelliert und begriffen werden können. Und ob ein solches Begreifen möglich ist oder nicht, hat erhebliche Konsequenzen: auf dem letztlich nicht-monetären Verständnis des Tausches beruhen alle klassisch-neoklassischen Beweise einer prinzipiellen Krisenfreiheit von Marktwirtschaften, während Marx in der Geldvermittlung des Tausches die allgemeinste Möglichkeit der Krise sieht (MEW 23, 227f).
Die Auffassungen Proudhons und der klassisch-neoklassischen Ökonomie können nur durch den Nachweis kritisiert werden, dass innerhalb der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft Wert überhaupt nicht ohne den Bezug auf Geld existieren kann, dass die Geldform des Werts also weit mehr als nur ein praktisches Hilfsmittel ist. Dies zu zeigen, ist der Anspruch der Wertformanalyse. Wenn Marx nach der oben zitierten Stelle über die „Genesis der Geldform“ fortfährt, „also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen Wertausdrucks von seiner einfachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform zu verfolgen“ (MEW 23, 62), dann geht es nicht um eine noch so abstrakt modellhaft gefasste vorbürgerliche Entwicklung hin zu bürgerlich-kapitalistischen Formen, sondern um die Beziehung von kapitalistisch produzierter Ware und Geld. Zwar war im ersten Kapitel des „Kapital“ noch nicht von kapitalistischer Produktion die Rede, aber bereits der erste Satz dieses Kapitels machte klar, dass die zur Diskussion stehende Ware keine vorbürgerliche, sondern kapitalistische ist. Was mittels Wertformanalyse gezeigt werden soll, ist, dass unter kapitalistischen Verhältnissen der Warenwert einen selbständigen und zugleich allgemeinen Wertausdruck benötigt; dass sich die Waren ohne einen solchen Wertausdruck als Werte überhaupt nicht aufeinander beziehen können. Wenn dieses Ergebnis der Wertformanalyse richtig ist, dann kann Wert in einer kapitalistischen Ökonomie nicht existieren (und nicht verstanden werden) ohne Bezug auf Geld. Dieses Ergebnis, das sich auf das Verhältnis von Wert und Geld bei entwickelter Warenproduktion bezieht, ist sowohl für Proudhon wie für Klassik und Neoklassik eine Neuigkeit und destruiert ihre theoretische Behandlung des Geldes.[3] Und weiter lässt sich, wenn dieses Ergebnis richtig ist, die Marxsche Werttheorie nicht auf die substanzialistische Arbeitsmengentheorie des traditionellen Marxismus reduzieren, die Wert bereits an der einzelnen Ware festzumachen sucht[4], sondern sie ist immer schon „monetäre“ Werttheorie.[5]
Von dem gerade skizzierten, nicht auf abstrakter, modellhafter Geschichtsdarstellung beruhenden Verständnis von „Genesis“ und „Entwicklung“ scheint Haug anzunehmen, dass es einem „hegelianisierenden Missverständnis“ auf den Leim gehe, das alles aus „einer ‚der Ware’ als solcher inhärenten Logik“ (Haug 2001, 269) hervorgehen lässt. Damit ist die Frage aufgeworfen, was den Gang der Darstellung (nicht nur der Wertformanalyse) strukturiert, wenn es eben nicht die abstraktifizierte Geschichte ist.
Im Stichwort „Historisches/Logisches“ liefert Haug zwei unterschiedliche Überlegungen zur Strukturierung der Darstellung in der Kritik der politischen Ökonomie. Zunächst heißt es: „Wenn sich in der Abfolge nach Komplexionsgraden Historisches im Sinne einer diachronen Ordnung ausdrückt, so in der Abfolge auf einem gegebenen Komplexionsniveau die synchrone Ordnung des Funktionellen“ (Haug 2003, 393) Dies legt nahe, dass sich die Abfolge der Darstellung nach zwei Ordnungsprinzipien richtet, wobei man sich die Abfolge von „Komplexionsgraden“, wohl als „genetische Entwicklung“ im Sinne einer modellhaften Rekonstruktion des Historischen vorzustellen hat. Ausgeblendet wird dabei die Möglichkeit, dass es in der Marxschen Darstellung um eine Abfolge von Komplexionsgraden geht, die nicht historisch (wie abstrakt auch immer) sondern gegenwärtig bestimmt sind: Rekonstruktion nicht einer historischen Entwicklung, sondern eines gegenwärtig vorfindlichen Zusammenhangs aus einfachen Momenten.
Im weiteren geht es bei Haug dann um die „Reihenfolge“ der Kategorien, allerdings ohne dass auf die zuvor angestellten Überlegungen zur „Abfolge“ eingegangen wird, oder angesprochen wird, ob Abfolge und Reihenfolge Verschiedenes bedeuten soll. Die Reihenfolge der Kategorien in der Darstellung wird verglichen mit der Reihenfolge ihres historischen Auftretens, und dabei kommt Haug zu dem Ergebnis, das der Gang der Darstellung der historischen Entwicklung entsprechen kann oder auch nicht (ebd., 395). Während der erste Fall gut mit der oben genannten Abfolge von Komplexionsgraden harmonieren würde, ist beim zweiten nicht zu sehen, wie er überhaupt zum ersten Schema passen soll. Aus einer Perspektive, die „genetische Entwicklung“ als modellhafte Rekonstruktion der Geschichte auffasst, müsste es doch als Problem erscheinen, wieso die Darstellung nicht nur statt des diachronen einen synchronen, sondern ab und zu sogar einen anti-diachronen Weg einschlägt. Leider wird eine solche Diskussion nicht geführt. Haug scheint der Ansicht zu sein, dass man über die Aufzählung dessen, was man bei Marx alles vorfinden kann, nicht hinauskommt, ja das alles weitere sogar schädlich wäre: Diesen Punkt abschließend heißt es: „Das Verlangen nach allgemeinen Patentformeln hat hier wie sonst zu unheilvoller Verwirrung geführt“ (ebd., 396).
Nun hatte Marx in der Einleitung von 1857 (aus der auch Haug viele Zitate entnimmt) zwar diskutiert, ob die Reihenfolge der Kategorien in der Darstellung der Reihenfolge ihres historischen Auftretens entspricht oder nicht, und hatte für beides Beispiele geliefert. Allerdings blieb er dabei nicht stehen, sondern gelangte am Ende seiner Diskussion zu einem eindeutigen Ergebnis, worin das Kriterium für die Reihenfolge der Darstellung besteht:
„Es wäre also untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben und die gerade das umgekehrte von dem ist, was als ihre naturgemäße erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht.“ (MEW 42, 41, Hervorhebung M.H.)
Dass Letzteres (die gegenüber der Historie „umgekehrte“ Reihenfolge) nicht immer der Fall ist, hatte Marx durch seine eigenen Beispiele belegt. Entscheidend ist aber überhaupt nicht die Parallelität oder Nicht-Parallelität der kategorialen Darstellung mit der historischen Entwicklung. Denn selbst wenn eine Parallelität vorliegt, liefert sie für die Darstellung keine Begründung. Was die Darstellungsabfolge der Kategorien begründen soll, ist ausschließlich die „Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben“ (Hervorhebung M.H.). Das ist zwar kein „Patentrezept“, aber doch eine klare Aussage, nach welchem Kriterium sich die Darstellung richten soll.[6]
Geld und Kapital: monetäre oder nicht-monetäre Theorie des Kapitals?
Nach der Darstellung der „einfachen Zirkulation“ von Ware und Geld leitet Marx die Untersuchung der „allgemeinen Formel des Kapitals“, G – W – G’, mit der Bemerkung ein:
„Neben dieser Form [gemeint ist die für die einfache Zirkulation charakteristische Form W-G-W, M.H.] finden wir aber eine zweite spezifisch unterschiedne, die Form G – W -G“ (MEW 23, 162, Hervorhebung M.H.)
Hier sieht es so aus, als stünden die beiden Zirkulationsformen einfach nebeneinander, wir „finden“ die eine wie die andere. Zwar ist die einfache Zirkulation Voraussetzung für die Existenz des Kapitals, doch ob Kapital tatsächlich existiert, scheint ihr äußerlich zu sein. Diese scheinbare Selbständigkeit der einfachen Zirkulation machte dann die auf Engels zurückgehende Vorstellung einer „einfachen Warenproduktion“ ebenso plausibel wie die Idee einer „sozialistischen Marktwirtschaft“.
In den Grundrissen (MEW 42, 159ff) und im Urtext von Zur Kritik der politischen Ökonomie (MEGA II. Abt., Bd. 2, 63ff) hatte Marx noch zu zeigen versucht, dass „Geld als Geld“ , d.h. Geld als verselbständigter Wert, nur von Dauer sein kann, wenn es die Form von sich verwertendem Wert (G – W – G’) annimmt. So wie die Wertformanalyse die strukturelle Beziehung zwischen Wert und Geldform des Werts aufdeckte, wurde dort gezeigt, dass die einfache Zirkulation als die ganze Ökonomie umfassend und Geld als selbständige Gestalt des Werts nur existieren können, wenn ihnen Kapital als sich verwertender Wert zugrunde liegt. Die einfache Zirkulation, d.h. eine die gesamte Ökonomie umfassende „Marktwirtschaft“ kann es somit nur geben, wenn diese Marktwirtschaft zugleich kapitalistisch ist. Dass dem so ist, d.h. dass sich die Warenform der Arbeitsprodukte nur unter kapitalistischen Verhältnissen verallgemeinert, wird im Kapital lediglich beiläufig als Faktum behauptet, aber nicht mehr begründet (MEW 23, 184, Fn. 41).
Wenn auch dort der angesprochene Übergang vom Geld ins Kapital fehlt, so macht Marx doch auf den spezifisch monetären Charakter des Kapitals aufmerksam. Als Kapital ist der Wert das „übergreifende Subjekt“ eines Prozesses, bei dem er abwechselnd Warenform und Geldform annimmt. Allerdings, so Marx weiter, bedarf der Wert
„einer selbständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konstatiert wird. Und diese Form besitzt er nur im Gelde. Dies bildet daher Ausgangspunkt und Schlußpunkt jedes Verwertungsprozesses.“ (MEW 23, 169).
Was Keynes knapp 70 Jahre später als schweres Geschütz gegen die Neoklassik auffährt, dass die Voraussetzung jedes kapitalistischen Produktionsprozesses die Verfügung über Geld ist, und es sich bei dieser Voraussetzung eben nicht um eine bloß formelle Angelegenheit handelt, wird bei Marx bereits auf einer viel grundsätzlicheren Ebene angesprochen.
Obgleich die marxsche Darstellung mit einer „monetären“ Werttheorie und einer „monetären“ Kapitaltheorie beginnt, wurde diese monetäre Seite sowohl von Marxisten als auch von Marx-Kritikern weitgehend ausgeblendet. Der marxistische Mainstream war geradezu stolz auf den vorgeblich nicht-monetären Charakter der Marxschen Akkumulations- und Krisentheorie – alles was mit Geld zusammenhing, galt als „bloßes Zirkulationsphänomen“. Und von keynesianischer Seite aus, d.h. aus der Perspektive der einzigen Richtung bürgerlicher Ökonomie, die Geld und Krise in ihrer Theoriebildung ernst nimmt, galt der nicht-monetäre Charakter der Marxschen Akkumulationstheorie als deren größtes Defizit (so z.B. Heine/Herr 1992).
Nach dem vierten Kapitel tauchen monetäre Fragen im ersten Band, mit Ausnahme weniger, vereinzelter Bemerkungen nicht mehr auf. Erst gegen Ende des zweiten Bandes und dann im umfangreichen V. Abschnitt des dritten Bandes, der von zinstragendem Kapital und Kredit handelt, geht es wieder explizit um monetäre Dimensionen. Dass im ersten Band monetäre Fragen über weite Teile keine Rolle spielen, ist nicht verwunderlich, ist sein Gegenstand doch der „Produktionsprozeß des Kapitals“. Nur lässt sich daraus nicht schließen, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nicht ohne Grund hatte Marx lange darauf bestanden, alle drei Bände auf einmal zu veröffentlichen. Dass der zweite Band erst 18 Jahre und der dritte erst 27 Jahre nach dem ersten Band erschien (also eine Generation später), hatte auf die Rezeption des „Kapital“ einen kaum zu unterschätzenden Einfluss. Nicht nur wurde der erste Band bis zum Erscheinen des dritten bereits breit diskutiert und in verschiedenen Einführungen popularisiert, es schien auch so, als enthalte er schon alles Wesentliche: die Wertbestimmung durch Arbeitszeit, den Nachweis von Ausbeutung trotz Äquivalententausch, die Analyse des destruktiven Charakters kapitalistischer Produktivkraftentwicklung, die Tendenz zur Bildung einer industriellen Reservearmee und zur relativen Verelendung. Und schließlich wurde im berühmten Schlussabschnitt des 24. Kapitels auch noch die historische Tendenz der kapitalistischen Akkumulation einschließlich der zukünftigen Überwindung des Kapitalismus skizziert. Alles Wichtige schien gesagt, und dieses Wichtige bezog sich im wesentlichen auf die Produktionssphäre. Die Bände zwei und drei konnten es dann wohl nur noch mit Spezialproblemen zu tun haben. Ihr im Vergleich zum ersten Band wesentlich spröderer Stil und ihr teilweise fragmentarischer Charakter trug zusätzlich dazu bei, dass sie als Stoff lediglich für „Experten“ angesehen wurden. Das nahezu einzige Thema, das auf breiteres Interesse stieß, war das „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“ und eine anscheinend darauf aufbauende Krisentheorie.
Dieses (häufig zusammenbruchstheoretisch interpretierte) „Gesetz“ versuchte Marx im wesentlichen aus den kapitalistischen Produktionsbedingungen zu begründen, wodurch es unmittelbar an die produktionsseitig ausgerichtete Rezeption des ersten Bandes angeschlossen werden konnte.[7] Und schließlich hatte Engels in seinem Bemühen, eine „lesbare“ Edition des dritten Bandes herzustellen, die krisentheoretischen Bemerkungen, in denen die Marxsche Untersuchung des „Gesetzes…“ ausläuft, so strukturiert, dass die Umrisse einer Krisentheorie sichtbar werden. Damit entstand der Eindruck, als versuche Marx im Anschluss an das „Gesetz…“ eine im Kern nicht-monetäre Krisentheorie zu formulieren. Das Originalmanuskript zum dritten Band ist viel weniger eindeutig (vgl. MEGA II. Abt. Bd. 4.2, 285-340).[8] Inhaltlich spricht vieles dafür, dass eine solche Theorie erst nach der Darstellung von zinstragendem Kapital und Kredit möglich ist. Aber genau dieser Punkt blieb im dritten Band am wenigsten ausgearbeitet und wurde auch jahrzehntelang kaum untersucht.[9]
Im Ergebnis wurde das Kapital als eine im wesentlichen nicht-monetäre Theorie begriffen; Krisenprozesse sollten allein in Veränderungen innerhalb der Produktion begründet sein. Geld und Kredit galten als etwas eher Zusätzliches: als Geld- und Kreditüberbau der mehr oder weniger krisenhaft funktionierenden kapitalistischen Produktion, der nur eine „abgeleitete“ und damit weniger wichtige Sphäre darstellt.
Kapital und Kredit
Im Gang der Darstellung entwickelt Marx zwar zunächst Produktions- und Zirkulationsprozess des Kapitals sowie die Durchschnittsprofitrate, ohne dass er dabei auf Kreditverhältnisse eingeht. Doch kann aus diesem Nacheinander der Darstellung genauso wenig wie beim Nacheinander der Darstellung von Ware und Geld geschlossen werden, dass das zuerst Dargestellte das Eigentliche sei, das auch allein existieren kann, zu dem das zweite nur in einer äußerlichen Beziehung steht.
Dass eine entwickelte kapitalistische Produktion und Zirkulation überhaupt nur unter Kreditverhältnissen möglich ist, wird im Kapital bereits an Stellen deutlich, an denen explizit noch gar nicht von Kredit die Rede ist. So tauchte im zweiten Band, bei der Untersuchung der Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals die Frage auf, wo das Geld zur Zirkulation des Mehrwerts herkommt: die Kapitalisten schießen in Geldform nur einen Wert von c + v vor, zirkuliert werden muss aber ein Gesamtprodukt im Wert von c + v + m. In mehreren Anläufen (MEW 24, 331-337; 417ff; 469ff; 495) erklärt Marx dies schließlich damit, dass einige Kapitalisten über einen Schatz verfügen, mit dem sie den Mehrwert anderer Kapitalisten realisieren können, noch bevor ihr eigener Mehrwert realisiert wurde. Danach verfügen diese anderen Kapitalisten über Geld, um nun ihrerseits den Mehrwert der ersten Kapitalisten zu realisieren. Dass die Zirkulation des Mehrwerts über „Schätze“ (also brachliegendes Kapital) vermittelt wird, ist natürlich eine anachronistische Annahme, die Marx nur deshalb machen muss, weil an dieser Stelle die Kategorien Zins und Kredit noch nicht entwickelt sind.
Der Kredit ist aber nicht bloß ein unvermeidlicher Mittler des kapitalistischen Zirkulationsprozesses, vor allem verleiht er der kapitalistischen Akkumulation ihre Elastizität. Bereits der Ausgleich der Profitraten (und damit die Steuerung der kapitalistischen Produktion über die Durchschnittsprofitrate) käme ohne Kredit nicht voran: die bei diesem Ausgleichsprozess unterstellten Kapitalbewegungen zwischen den einzelnen Produktionssphären beruhen in erster Linie auf einer Verschiebung der Kredite für zusätzliche Investitionen. Ohne Kredit könnte ein Kapitalist allenfalls den Profit der Vorperiode akkumulieren, die für kapitalistischen Produktionsverhältnisse typischen schnellen Kapitalbewegungen wären damit aber unmöglich.
Das Kreditsystem verteilt aber nicht einfach nur eine bereits vorhandene Geldmenge um. Marx betont, dass „die Banken Kapital und Kredit kreieren“ (MEW 25, 558): Mit dem Kreditgeld, d.h. Zahlungsversprechen, die zirkulieren und dabei als Geld fungieren, existiert die Möglichkeit der Geldschöpfung „aus dem Nichts“ (wie auch der Geldvernichtung „ins Nichts“, wenn die Zahlungsversprechen eingelöst werden). Sofern die sachlichen Voraussetzungen des Akkumulationsprozesses existieren, kann durch den Kredit nicht nur die Akkumulation eines einzelnen Kapitalisten, sondern auch die Akkumulation des Gesamtkapitals größer werden als die Summe der Profite der Vorperiode. Mangelnder Kredit kann Produktion und Akkumulation erheblich einschränken, steht ausreichend Kredit zur Verfügung, dann können Produktion und Akkumulation „bis zur äußersten Grenze forciert“ werden, wodurch der Kredit zugleich zum „Haupthebel der Überproduktion und Überspekulation im Handel“ wird (MEW 25, 457).
Dafür benötigt das Kreditsystem selbst ein Höchstmaß an Elastizität. Diese erreicht es durch die Produktion eigener Instrumente[10], zunächst des Kreditgeldes, dann des „fiktiven Kapitals“ (MEW 25, 482ff; vgl. auch Krätke 1995, 2000). Fiktives Kapital sind handelbare Ansprüche auf zukünftige Zahlungen, also vor allem öffentliche oder private Schuldtitel (sie beinhalten den Anspruch auf Zins- und Tilgungszahlungen) sowie Aktien (sie beinhalten den Anspruch auf Dividendenzahlung). Der Markt- oder Kurswert dieser Titel ergibt sich im Prinzip aus der Diskontierung der jeweiligen Gewinnerwartung mit dem aktuellen Marktzins und einem vom Gegenstand und der jeweiligen Situation abhängigen Risikoauf- oder -abschlag.[11] Marx bezeichnet diese Titel deshalb als „fiktives Kapital“, weil sie sich nicht auf tatsächliche Werte beziehen (wie man sie z.B. nach der Verwandlung von Geld in industrielles Kapital erhält), sondern sie lediglich auf der Berechnung eines vorgestellten Kapitalwerts beruhen. Die „Finanzinnovationen“, die in den letzten Jahrzehnten auf den Finanzmärkten entwickelt wurden, indem neue Arten von Ansprüchen (z.B. auf in Geld umgerechnete Indexpunkte eines Aktienindex) geschaffen wurden, stellen nichts anderes als immer neue Konstruktionen von fiktivem Kapital dar.
Ausdehnung oder Einschränkung der Akkumulation (sowohl was das Gesamtkapital als auch was einzelne Branchen angeht) hängen ganz wesentlich davon ab, ob und zu welchen Bedingungen innerhalb des Kredit- und Finanzsystems Mittel nachgefragt und bereitgestellt werden. Insofern wirkt das Kreditsystem als eine strukturelle Steuerungsinstanz der kapitalistischen Akkumulation. Relevant für diese Steuerung sind aber nicht in erster Linie die früher erzielten Profite, sondern die Erwartung zukünftiger Profite und die Einschätzung des jeweiligen Risikos – Größen, die sich sehr schnell ändern können, was dann auch erhebliche Auswirkungen auf die Produktion hat.[12]
Mit der Einsicht in die zentrale Rolle des Kredit- und Finanzsystems wird nicht-monetären, lediglich an den Produktionsbedingungen orientierten Krisentheorien, wie sie für den traditionellen Marxismus charakteristisch waren, der Boden entzogen: Krisenprozesse lassen sich nur aus dem unauflöslichen Zusammenhang von Produktions- und Zirkulationsprozess des Kapitals verstehen. Auch Marx’ allgemeinste Charakterisierung kapitalistischer Krisenprozesse hebt auf den Widerspruch zwischen den Bedingungen der Exploitation und der Realisierung des Mehrwerts ab (MEW 25, 254f), und letztere hängen entscheidend von Umfang und Wirkungsweise des Kreditsystems ab (was an der betreffenden Stelle nicht ausgeführt wird, da die Kategorie des Kredits noch nicht entwickelt wurde).
Kapitalistische Produktion und Finanzsystem sind untrennbar verbunden, insbesondere lässt sich kein prinzipieller Unterschied zwischen einer „produktiven kapitalistischen Akkumulation“ und einer „unproduktiven Spekulation“ an den Finanzmärkten aufmachen. Spekulativ ist nicht nur der Kauf einer Aktie oder eines Optionsscheins, auch jede Investition in einen kapitalistischen Produktionsprozess trägt ein spekulatives Moment in sich: kein Kapitalist kann sicher sein, in welchem Umfang und zu welchem Preis er seine Produkte absetzen wird, daher kann er auch nie wissen, ob seine Investition tatsächlich den erwarteten Profit bringen wird. Zu unterscheiden ist nicht zwischen Spekulation und Produktion, sondern hinsichtlich der Gegenstände, Zeithorizonte und Risiken der Spekulation. Und nicht zuletzt geht es in der Sphäre kapitalistisch-industrieller Produktion genauso wie in der Kredit- und Finanzsphäre um den einzigen Zweck, den das Kapital kennt: die Maximierung von Profit.
Aus den schroffen Gegenüberstellungen von kapitalistischer Produktion und Kredit resultieren häufig recht einseitige Auffassungen der Funktionsweise des gegenwärtigen Finanzsystems. So wird innerhalb der globalisierungskritischen Debatten vor allem die restriktive Wirkung der Finanzmärkte auf den Akkumulationsprozess hervorgehoben und dafür mitunter die „Gier“ einzelner Protagonisten verantwortlich gemacht:
„Wenn Banken oder andere Finanzunternehmen aus Gier und kurzfristigem Gewinninteresse unsachgemäß mit den Institutionen einer modernen Geldwirtschaft umgehen, kommt es zu Finanzkrisen. Diese produzieren Kettenreaktionen mit dramatischen Folgen.“ (Huffschmid 1999, 13).
Andererseits sehen Zusammenbruchstheoretiker wie Robert Kurz im Finanzsystem die bloße „Simulierung“ von Profitabilität, die den (eigentlich schon längst eingetretenen) Zusammenbruch des Kapitalismus noch eine Weile hinausschieben würde (Kurz 1995; 1999).
Mit dem obigen Verweis auf die Entwicklung der Finanzinnovationen der letzten Jahrzehnte und der konkreten institutionellen Ausgestaltung des Kreditsystems ist der Punkt erreicht, an dem die Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise „in ihrem idealen Durchschnitt“ (MEW 25, 839) an ihre Grenze stößt. Nicht um den Umfang seines Werkes zu begrenzen, sondern aus durchaus systematischen Gründen wollte Marx im Abschnitt über das zinstragende Kapital zum Kreditwesen „nur einige wenige Punkte“ hervorheben, „notwendig zur Charakteristik der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt“ (MEW 25, 413). Die konkrete Funktionsweise des Kreditsystems ändert sich nämlich erheblich mit der Geldverfassung, der Organisation des Bankenwesens, der Einrichtung einer staatlichen Zentralbank etc.
Was sich in den letzten drei Jahrzehnten herausgebildet hat und vom Mainstream der Globalisierungskritiker als „entfesselter“ Kapitalismus aufgefasst wird, ist nichts anderes als ein internationalisiertes Finanzsystem als Steuerungszentrum eines globalen Konkurrenzkapitalismus. Neu daran ist nicht der Einfluss des Finanzsystems. Neu ist vielmehr dass das Finanzsystem zunehmend markt- statt bankorientiert ist, was die Bedeutung des fiktiven Kapitals beträchtlich erhöht[13] und vor allem dass das Finanzsystem jetzt internationalisiert ist, womit – dies macht den Kern der „Globalisierung“ aus – auch die Standards der Kapitalverwertung zunehmend internationalisiert werden (Altvater/Mahnkopf 1999). Ein Zurück zu nationalstaatlichen Regulierungen und Wirtschaftswunderzeiten wird es hier zwar nicht mehr geben, allerdings ist die institutionelle Gestalt und die politische Regulierung dieses internationalisierten Finanzsystems noch längst nicht bestimmt.
Innerhalb des globalen Konkurrenzkapitalismus haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten die Rolle und die Einflussmöglichkeiten der Nationalstaaten zwar erheblich verändert, allerdings kann keine Rede davon sein, dass die Nationalstaaten ihre Bedeutung verloren hätten und sich das internationale System in ein diffuses Empire transformiert habe, wie Hardt/Negri (2002) meinen. Der globale Konkurrenzkapitalismus geht mit einem nationalstaatlich fragmentierten politischen System einher, das zwar eine eindeutige Hegemonialmacht besitzt, die USA, deren Hegemonie jedoch in den letzten zehn Jahren durch die spezifische Konstellation einiger Mittelmächte punktuell in Frage gestellt wird. Am deutlichsten zeigt sich dies beim Euro, dessen Einführung zumindest die Möglichkeit eröffnet, eines Tages den Dollar als Weltgeld zu ersetzen. Wie weit die machtpolitischen Interessen inzwischen auseinander laufen, machte nicht zuletzt der Konflikt um den Irakkrieg deutlich. Die institutionelle Ausgestaltung und politische Regulierung des internationalen Finanzsystems wird ganz wesentlich von den welt- und währungspolitischen Differenzen der verschiedenen Machtblöcke bestimmt sein. Ob bei den Regulierungen, die in Zukunft entstehen werden, aber tatsächlich ein freundlicherer Kapitalismus herauskommt, ist mehr als fraglich.
Literatur
Altvater, Elmar; Mahnkopf, Birgit (1999): Grenzen der Globalisierung. Münster.
Backhaus, Hans-Georg (1997): Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur Marxschen Ökonomiekritik, Freiburg.
Groh, Dieter (1973): Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt/M.
Haug, Wolfgang Fritz (2001): „Genesis“, in: HKWM 5, 261-274.
Haug, Wolfgang Fritz (2003): „Historisches/Logisches“, vgl. den Artikel in diesem Heft, S.385-403.
Hein, Eckhard (1998): Karl Marx, ein klassischer Ökonom? Zur Bedeutung von Geld und Zins in der Marxschen Ökonomie und den Implikationen für eine Theorie der Kapitalakkumulation, in: PROKLA 110, S.139-162.
Heine, Michael; Herr, Hansjörg (1992): Der esoterische und der exoterische Charakter der Marxschen Geldtheorie – eine Kritik, in: Schikora, Andreas u.a. (Hrsg.), Politische Ökonomie im Wandel. Festschrift für Klaus Peter Kisker, Marburg, S.195-210.
Heinrich, Michael (1996/97): Engels’ Edition of the Third Volume of ‘Capital’ and Marx’s Original Manuscript, in: Science & Society, Vol. 60, No. 4, Winter.
Heinrich, Michael (1999): Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, überarb. u. erw. Neuaufl., Münster.
Heinrich, Michael (2001): Monetäre Werttheorie. Geld und Krise bei Marx, in PROKLA 123, 151-176.
Holzkamp, Klaus (1974): Die historische Methode des wissenschaftlichen Sozialismus und ihre Verkennung durch J. Bischoff, Das Argument 84.
Huffschmid, Jörg (1999): Die politische Ökonomie der Finanzmärkte, Hamburg.
Keynes, John Maynard (1936): Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin 1983.
Kittsteiner, Heinz-Dieter (1977): „Logisch“ und „historisch“. Über Differenzen des Marxschen und des Engelsschen Systems der Wissenschaft (Engels’ Rezension „Zur Kritik der politischen Ökonomie“), in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 13.Jg., Heft 1, S.1-47.
Krätke, Michael (1995): Stichworte „Bank“ und „Banknote“, in: HKWM 2, 1-21 und 22-27.
Krätke, Michael (2000): Geld, Kredit und verrückte Formen, unv. Manuskript
Kurz, Robert (1995): Die Himmelfahrt des Geldes, in: Krisis 16/17, S.21-76.
Kurz, Robert (1999): Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft, Frankfurt/M
Mandel, Ernest (1962): Marxistische Wirtschaftstheorie, Frankfurt/M.
Meek, Ronald L. (1956): Studies in the Labour Theory of Value, Second Edition, London 1975.
Milios, John; Dimoulis, Dimitri; Economakis, George (2002): Karl Marx and the Classics. An essay on value, crises and the capitalist mode of production, Ashgate.
Rakowitz, Nadja (2000): Einfache Warenproduktion. Ideal und Ideologie, Freiburg.
Rubin, Isaak I. (1924): Studien zur Marxschen Werttheorie, Frankfurt/M 1973.
Sweezy, Paul M. (1942): Theorie der kapitalistischen Entwicklung, Frankfurt/M 1970.
Vollgraf, Carl-Erich, Jungnickel, Jürgen (1995): Marx in Marx’ Worten? Zu Engels’ Edition des Hauptmanuskripts zum dritten Buch des ‘Kapitals’, in: MEGA-Studien 1994/2, S.3-55.
[1] Marxsche Äußerungen zu dieser Rezension sind nicht bekannt, wahrscheinlich gibt es keine. Auch im ersten Band des Kapitals, in dem Marx mehrfach ökonomische Schriften von Engels zitiert, wird sie nicht erwähnt, obwohl sich dies im Vorwort und bei einigen Textstellen inhaltlich anbieten würde – wenn Marx mit ihrem Inhalt einverstanden gewesen wäre. Eine höchst lesenwerte Auseinandersetzung mit dieser Rezension vor dem Hintergrund unterschiedlicher Wissenschaftskonzeptionen bei Marx und Engels ist Kittsteiner (1977).
[2] Ebenso selbstverständlich heißt es im Stichwort „Historisches/Logisches“, das Genetische könne „als das modellhaft begriffene Historische“ verstanden werden.
[3] Für die mangelhafte Auffassung des Zusammenhangs von Wert und Wertform bei Smith und Ricardo macht Marx keine Defizite in der Erfassung der historischen Herausbildung des Geldes verantwortlich, sondern Defizite in der Erfassung der Wertform des Arbeitsproduktes als „allgemeinste Form der bürgerlichen Produktionsweise“ (MEW 23, 95, Fn. 32, Hervorhebung von mir).
[4] Allerdings hat Marx diesem substanzialistischen Verständnis durch eine ganze Reihe von Ambivalenzen seiner Darstellung erheblich Vorschub geleistet, vgl. dazu (Heinrich 1999, Kapitel 6).
[5] Dass die Marxsche Werttheorie „monetäre Werttheorie“ und damit Kritik prämonetärer Werttheorien ist, zu denen gleichermaßen die klassische Arbeitswertlehre, die neoklassische Nutzentheorie des Werts aber auch die vom traditionellen Marxismus vertretene „marxistische Arbeitswerttheorie“ gehört, hat vor allem Hans-Georg Backhaus in den 70er Jahren herausgestellt (vgl. seine gesammelten Aufsätze in Backhaus 1997). Erste Überlegungen, die in eine teilweise ähnliche Richtung gingen, stellte in den 20er Jahren Rubin (1924) an. In unterschiedlicher Weise wurde die monetäre Auffassung der Werttheorie u.a. bei Hein (1998), Heinrich (1999; 2001), Rakowitz (2000) und Milios/Dimoulis/Economakis (2002) weiterentwickelt.
[6] Ebenso eindeutig heißt es zur Erklärungskraft der geschichtlichen Entwicklung für die gegenwärtigen Verhältnisse: „Die bürgerliche Gesellschaft ist die entwickeltste und mannigfaltigste historische Organisation der Produktion. Die Kategorien, die ihre Verhältnisse ausdrücken, das Verständnis ihrer Gliederung gewähren daher zugleich Einsicht in die Gliederung aller der untergegangenen Gesellschaftsformen…. Die Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen“ (MEW 42, 39, Hervorhebung M.H.). Genetische Rekonstruktion verstanden als modellhafte Darstellung der Geschichte liefe dagegen darauf hinaus, die Anatomie des Affen zum Schlüssel für die Anatomie des Menschen zu erklären.
[7] Ob Marx eine schlüssige Begründung dieses Gesetzes gelungen ist, bzw. ob sich eine solche Begründung überhaupt liefern lässt, ist heftig umstritten. In Heinrich (1999, 327ff) habe ich mich mit wesentlichen Beiträgen dieser Debatte auseinandergesetzt und zu zeigen versucht, dass es keine konsistente Begründung für dieses „Gesetz“ geben kann.
[8] Vgl. zur Engelsschen Edition des dritten Bandes Vollgraf/Jungnickel (1995) sowie Heinrich (1995/96).
[9] Für lange Zeit blieb Hilferding (1910) das einzige marxistische Werk dazu. Allerdings beschränkte sich Hilferding nicht nur auf eine selektive Auseinandersetzung mit der Marxschen Kredittheorie, diese beruhte auch auf einer fragwürdigen, im Grunde quantitätstheoretischen Lesart der Marxschen Geldtheorie.
[10] „Produziert“ werden diese Instrumente von Banken und anderen „Finanzdienstleistern“, um ihren eigenen Profit zu steigern. Dass Nachfrage nach ihnen besteht, liegt in ihrem „Gebrauchswert“, d.h. ihrer jeweiligen Funktionalität hinsichtlich Flexibilität, Risikoabsicherung etc. begründet.
[11] „Diskontierung mit dem Marktzins“ bedeutet, das berechnet wird, wie groß ein Kapital wäre, das beim aktuellen Marktzins den erwarteten Gewinn des jeweiligen Titels abwerfen würde. Wird das Risiko als überdurchschnittlich eingeschätzt, liegt der Kurswert etwas unter diesem Wert, wird es als unterdurchschnittlich eingeschätzt liegt er etwas darüber. Da sich der Marktzins und vor allem die Risikoeinschätzung kurzfristig stark ändern können, kann es zu erheblichen Schwankungen der Kurse und damit des „Werts“ des fiktiven Kapitals kommen.
[12] Der Kredit als Steuerungsinstanz der kapitalistischen Akkumulation wurde von Marx im Kapital nur rudimentär entwickelt (MEW 25, 451ff und 620), obgleich er sich bereits in den Grundrissen über diesen Sachverhalt im Klaren war: „Im Geldmarkt ist das Kapital in seiner Totalität gesetzt; darin ist es preisbestimmend, arbeitgebend, die Produktion regulierend, in einem Wort Produktionsquelle“ (MEW 42, 201, Hervorhebungen im Original). Ausführlicher dazu Heinrich (1999, 299ff).
[13] Der Übergang vom bank- zum marktorientierten Finanzsystem zeigt sich unter anderem daran, dass Unternehmen, viel häufiger als früher direkt an den Kapitalmarkt gehen und sich dort das benötigte Kapital über die Ausgabe von Aktien oder Anleihen (also die Schaffung von fiktivem Kapital) besorgen, statt Kredite bei ihren „Hausbanken“ aufzunehmen.